[FAU Freiburg]
Ein FAU Mitglied arbeitete mehrere Tagen in einem Fitnessstudio bevor das Arbeitsverhältnis einvernehmlich beendet wurde. Den Lohn für ihre Arbeit erhielt sie jedoch nicht! Die Kollegin gab sich damit aber nicht zufrieden und holte sich Rat und Unterstützung. Am Ende konnte eine zufriedenstellende außergerichtliche Einigung erzielt werden.
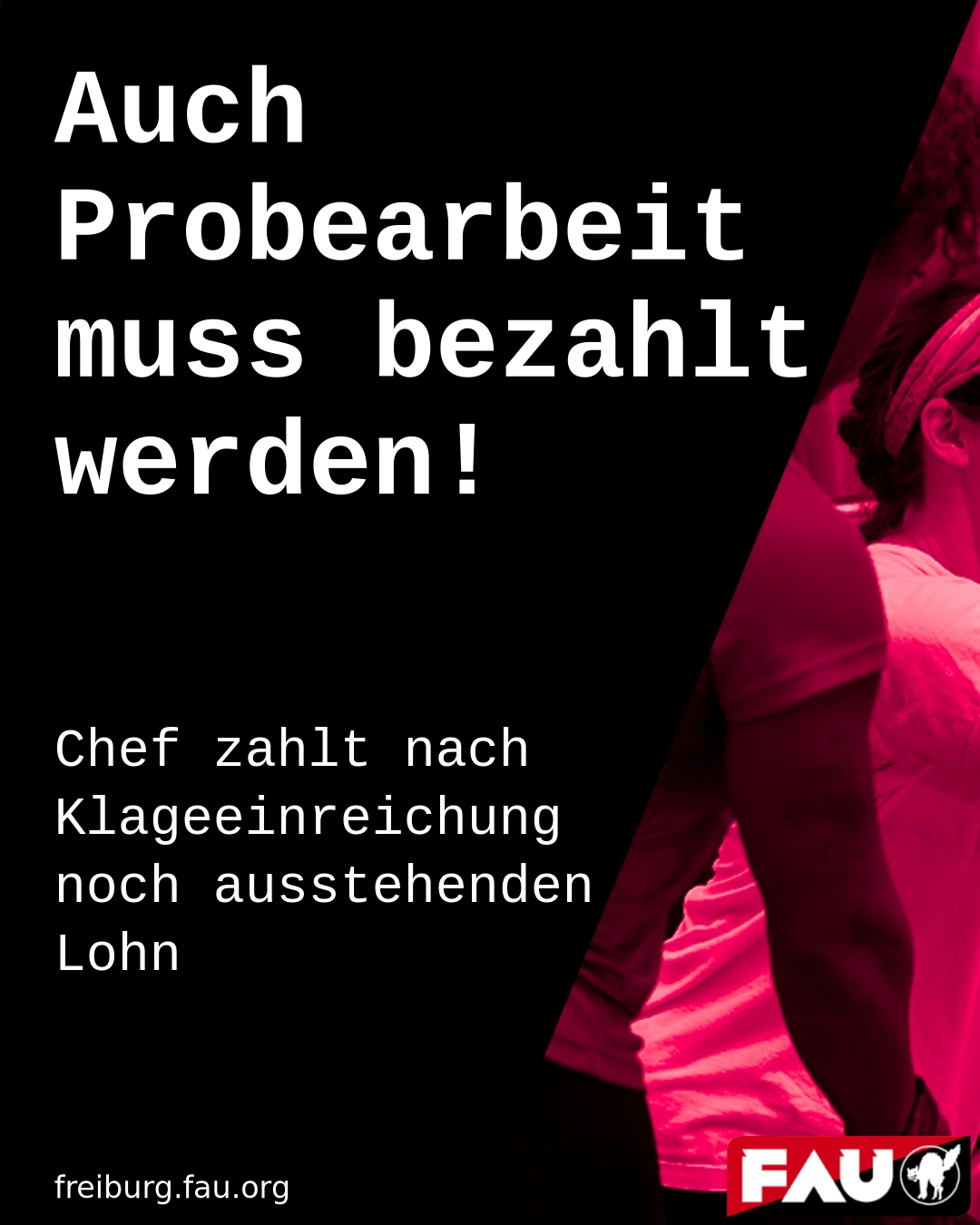
Das betroffene FAU Mitglied verabredete mit ihrem Chef ein Probearbeiten. Nach diesem Kennenlernen der Arbeit wurde via Messenger mündlich ein unbefristetes Arbeitsverhältnis vereinbart. Sie wurde durch eine Kollegin in den Schichtplan eingetragen und arbeitete an drei Terminen – zeitweise völlig eigenständig. Die Arbeitszeiten wurden ihr durch den Chef vorgegeben. Sie übernahm die selben Aufgaben wie alle anderen Mitarbeiter:innen auch. Aufgrund unterschiedlicher die Arbeit betreffender Vorstellungen wurde das Arbeitsverhältnis einvernehmlich beendet. Als die Kollegin nach ihrer Bezahlung für die geleistete Arbeit fragte, winkte der Chef ab. Wiederholte Kontaktversuche wurden abgeblockt.
Die Kollegin wollte das so aber nicht akzeptieren und holte sich Rat und Unterstützung. Gemeinsam wurde ein Forderungsschreiben verfasst und eine Klage beim Arbeitsgericht eingereicht. Der Druck wirkte: Plötzlich bewegte sich der Arbeitgeber und die Kollegin konnte – ohne aufwändigen Gerichtsprozess – eine für sie zufriedenstellende außergerichtliche Einigung erzielen. Der Chef zahlte ihr eine niedrige dreistellige Summe. Oft sind Chefs der Meinung „Probearbeit“ müssten sie nicht bezahlen. Dies stimmt so nicht! Fakt ist: Sobald man an Weisungen des Chefs gebunden ist, nicht kommen- und gehen darf wann man will (z.B. feste Einteilung in einen Schichtplan) und die selben Arbeiten ausführt wie alle anderen Mitarbeiter:innen muss man dafür auch bezahlt werden. Das, was umgangssprachlich häufig als „Probearbeiten“ bezeichnet wird, heißt juristisch korrekt eigentlich „Einfühlungsverhältnis“ – das liegt aber nur vor, wenn man tatsächlich die Rolle eines Besuchers hat. Gehen die Verpflichtungen weiter als das, kann ein Anspruch auf Bezahlung entstehen.
Manche Unternehmen nutzen die Unwissenheit vieler Arbeiter:innen immer wieder aus und prellen diese um ihren Lohn: Auch im vorliegenden Fall „probearbeitete“ eine Mitarbeiterin des FAU-Mitglieds schon sage und schreibe 6 Wochen ohne Bezahlung!
Vorliegender Fall zeigt aber auch: Es lohnt sich, seine Rechte zu kennen!
Wir können alle Arbeiter:innen nur dazu ermutigen, sich an entsprechende Beratungsstellen zu wenden und sich gewerkschaftlich zu organisieren. Nur gemeinsam können wir unsere Rechte verteidigen!
Material: Broschüre „Deine Rechte im Job – Eine Einführung ins Arbeitsrecht und erste Schritte des Organizing“
Quelle: Probearbeit bezahlen